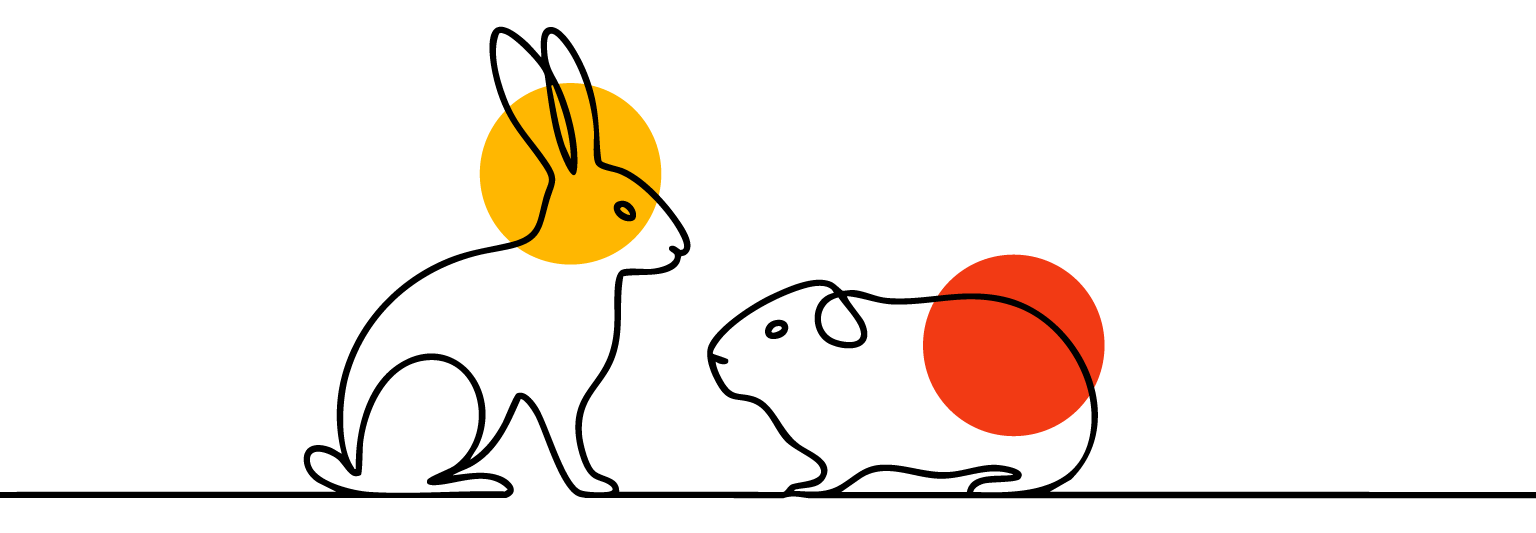Ist ein Mops wirklich immer „mopsfidel“? Leider nein, denn seine extrem kurze Nase sorgt häufig für Schwierigkeiten beim Atmen, seine Augen sind anfällig für Verletzungen und die tiefen Hautfalten können zu Entzündungen führen. Viele Möpse haben sogenannte Defektmerkmale, die ihr alltägliches Leben stark beeinträchtigen. Auch Katzen mit Knickohren, Kaninchen mit besonders kleinem Körper oder Schlangen in spektakulären Farbmustern haben auf den zweiten Blick gesundheitliche Probleme. Kurz gesagt: Nicht alles, was auf den ersten Blick niedlich aussieht, ist auch gut für das Tier. Manche dieser Qualzucht-Merkmale können für das Tier schmerzhaft oder lebenslang belastend sein.
Was bedeutet „Qualzucht“?
Qualzucht bezeichnet die selektive Zucht auf bestimmte Merkmale bei Tieren, obwohl diese Merkmale zu Schmerzen, Leiden, Schäden oder Verhaltensstörungen führen. Das bedeutet, die Tiere werden gezielt auf extreme äußere Merkmale („Übertypisierung“) hin gezüchtet, die besonders oder außergewöhnlich aussehen oder gerade in Mode sind. Manchmal sogar, obwohl bekannt ist, dass diese Merkmale das Tierwohl erheblich beeinträchtigen können. Man spricht dabei auch von Extremzucht bzw. Defektzucht. Beispiele sind besondere Farbvarianten („Lemon Frost“ bei Leopardgeckos oder „Merle“ bei Hunden), Haarlosigkeit oder bestimmte Körperformen wie Zwergwuchs, verkürzte Schnäbel oder übermäßig lange Ohren.
Qualzucht ist verboten
Das deutsche Tierschutzgesetz (§11b TierSchG) verbietet Tiere so zu züchten oder gentechnisch zu verändern, dass man mit hoher Wahrscheinlichkeit damit rechnen muss, dass die Nachkommen körperliche Schäden haben, zum Beispiel fehlende oder nicht richtig funktionierende Organe oder Körperteile, und dadurch Schmerzen, Leiden oder gesundheitliche Schäden entstehen, oder dass bei den Nachkommen Verhaltensstörungen auftreten, die mit Leiden verbunden sind.
In Deutschland gibt es also Regelungen, die Qualzucht verhindern sollen. Allerdings ist der Nachweis, dass ein Tier unter bestimmten Merkmalen tatsächlich leidet, oft schwierig. Die Kriterien, ab wann zum Beispiel eine kurze Nase zu kurz ist, sind außerdem nicht eindeutig genug festgelegt. Der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) fordert daher auf der Webseite #Qualzucht verhindern eine bundesweit einheitliche Regelung, welche Merkmale genau als Qualzucht gelten.
Grenzen der ethisch vertretbaren Tierzucht
Wo liegen die Grenzen einer ethisch vertretbaren Tierzucht? Dr. Stefan K. Hetz, wissenschaftlicher Fachreferent für Heimtiere beim Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe (ZZF), erläutert in diesem Video wichtige Begriffe wie selektive Züchtung und Domestikation sowie die Auswirkungen von Extremzucht auf das Tierwohl.
So erkennst du Merkmale von Qualzucht
Die Liste der Symptome, die erblich bedingt bei unseren tierischen Begleitern auftreten können, ist lang: Lähmungen, Taubheit, chronische Schmerzen, Atemnot, unkontrolliertes Muskelzucken sind nur einige Beispiele, hinzu kommt das erhöhte Risiko von äußeren Verletzungen, etwa bei schuppenlosen Echsen. Die Übertypisierungen können außerdem die Kommunikation der Tiere mit ihren Artgenossen einschränken.
Qualzucht lässt sich nicht immer auf den ersten Blick erkennen. Einige typische Anzeichen können aber ein Hinweis sein:
- Auffälliges Aussehen: Je extremer, skurriler oder „unnatürlicher“ ein Tier aussieht, desto größer ist das Risiko, dass seine Gesundheit beeinträchtigt sein könnte. Hat das Tier einen für seine Art extrem kleinen Körper („Teacup“-Züchtungen), stark verkürzte Beine oder übermäßig lange Ohren? Hat der Hund, die Katze oder die Ratte kein Fell oder der Vogel so viele Federn auf dem Kopf, dass seine Sicht behindert ist? Fehlen beim Fisch dort Flossen, wo eigentlich Flossen hingehören? Das können Anzeichen für eine Qualzucht sein.
- Körperliche Anzeichen: Besonders bei Hunden und Katzen ist die sogenannte Brachyzephalie, also eine kurze, runde Kopfform mit flacher Nase, mit gesundheitlichen Problemen verbunden. Typische brachyzephale Rassen sind zum Beispiel bestimmte Zuchtlinien von Französischen Bulldoggen, Pekinesen und Shih Tzu. Die Brachyzephalie kann zu pfeifenden Atemgeräuschen bis zu Atemnot oder im Schlaf zu Atemaussetzern führen. Die Tiere sind anfälliger für einen Hitzschlag, weil sie nicht effektiv genug hecheln können. Auch Augenprobleme wie ständiges Tränen und Zahnprobleme durch zu wenig Platz im Kiefer sind mögliche Symptome.
- Verhaltensauffälligkeiten, die direkt oder indirekt durch die körperlichen Einschränkungen entstehen: Aufgrund von körperlichen Schmerzen oder Atemproblemen vermeiden die Tiere Bewegung und ermüden schneller. Ist das Seh- oder Hörvermögen beeinträchtigt, neigen die Tiere möglicherweise zu Unsicherheit oder Schreckhaftigkeit. Das „Im-Kreis-laufen“ und das dauerhafte Kopfneigen können ein Hinweis auf neurologische Störungen sein, die bei Tieren mit bestimmten Qualzucht-Merkmalen vermehrt vorkommen.
Ein einzelnes Merkmal bedeutet nicht automatisch, dass ein Tier unter zuchtbedingten Defekten leidet – entscheidend ist, ob dieses Merkmal die Gesundheit, das Verhalten oder die Lebensqualität einschränkt.
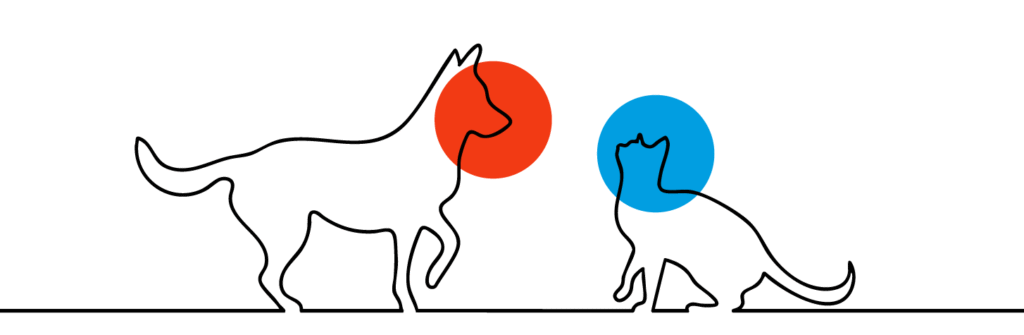
Gemeinsam für mehr Tierwohl: Was du tun kannst
Jede Tierart ist auf ihre Weise faszinierend und alle Heimtiere haben einen ganz eigenen Charakter, den Tierfreunde entdecken können. Der Wunsch nach dem Besonderen kann Leiden und Schäden für Tiere zur Folge haben. Wer überlegt, ein Heimtier aufzunehmen, hat die Chance, bewusst zu handeln und einen wichtigen Beitrag zum Tierwohl zu leisten.
1. Informiert entscheiden
Informiere dich gründlich, bevor du dich für eine bestimmte Rasse oder Zucht entscheidest: Welche Merkmale sind problematisch und haben gesundheitliche Risiken? Frage auch beim Züchter offen nach: Wurde auf das Wohl des Tieres bei der Zucht geachtet?
2. Auf seriöse Herkunft achten
Verantwortungsvolle Züchter legen Wert auf gesunde Tiere statt auf modische Trends.
3. Keine extremen Trends unterstützen
Lass dich bei Heimtieren nicht von Trends oder Prominenten beeinflussen, die Tiere mit übertriebenen Zuchtmerkmalen zeigen. Auch wer kein eigenes Heimtier hat, sollte Haltung und Präsentation von solchen Tieren kritisch hinterfragen.
4. Wissen weitergeben
Auch Gespräche im Familien- oder Freundeskreis können helfen, ein besseres Bewusstsein für die Problematik von Qualzucht und für mehr Tierwohl zu schaffen.
5. Kein Like für Tierleid
Bilder und Videos von Tieren mit extremen Zuchtmerkmalen wirken oft niedlich oder verhalten sich außergewöhnlich – doch jedes Like, jeder Kommentar und jede geteilte Story steigert ihre Reichweite. Wer Tierleid verhindern möchte, sollte solche Inhalte weder positiv bewerten noch teilen. Unterstütze lieber Beiträge zu gesunden, artgemäß gehaltenen Tieren – so lenkst du Aufmerksamkeit dorthin, wo sie dem Tierwohl wirklich dient.
Wer Tiere liebt, dem sollten ihre Gesundheit und
ihr Wohlbefinden wichtiger als das Aussehen sein.
Mehr Infos unter #Qualzucht verhindern
Du möchtest dich noch genauer über das Thema Qualzucht informieren? Auf der Webseite #Qualzucht verhindern hält der Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe (ZZF) weitere wichtige Informationen bereit: